Aktuelles/alle Beiträge
Was passiert, wenn Moore wieder nass sind?
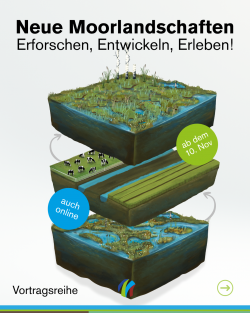
Neue Vortragsreihe
05/11/2025 In der sechsteiligen öffentlichen Vortragsreihe „Neue Moorlandschaften“ berichten Forscher*innen, wie aus trockengelegten Flächen neue Ökosysteme entstehen, wie sie funktionieren - und welche Chancen sie bieten. Die Vortragsreihe begleitet den Sonderforschungsbereich WETSCAPES2.0 an der Universität Greifswald, der die Funktionsweise wiedervernässter Niedermoore erforscht.
Den Auftakt macht Prof. Dr. Jürgen Kreyling, Sprecher von WETSCAPES2.0, mit seinem Vortrag „Moorlandschaften 2.0 – Was ist das und wie funktionieren sie?“
Montag, 10. November 2025, 18 Uhr
Alfried Krupp Wissenschaftskolleg, Martin-Luther-Straße 14, Greifswald
Online-Teilnahme möglich über den digitalen Hörsaal des Kollegs
Weitere Informationen und Termine:
https://www.wiko-greifswald.de/programm/vortraege/vortragsreihen-im-sommersemester-2025/wetscapes-20/
Der Sonderforschungsbereich/Transregio 410 WETSCAPES 2.0 wird gefördert von der Deutschen Forschungsgesellschaft (DFG) und getragen von der Universität Greifswald und der Universität Rostock.
Peatland Breakthrough
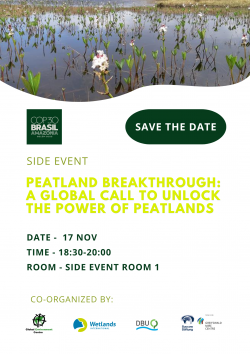
auf der COP30 in Brasilien
04/11/2025 Ein globaler Aufruf, das Potenzial von Moorgebieten für Klima, Natur und Menschen zu erschließen. Diese offizielle Side event der COP30 wird untersuchen, wie der Durchbruch für Moore globale Maßnahmen vorantreibt und Länder, Gemeinden und Unternehmen zusammenbringt, um eines der kohlenstoffreichsten Ökosysteme der Welt wiederherzustellen und zu schützen.
💚 Montag, 17. November 2025, 18:30–20:00 Uhr (GMT-3)
💚 Nebenveranstaltung Raum 1, Blue Zone, UNFCCC COP30, Belém, Brasilien
💚 Persönliche Teilnahme, hier registrieren (PEATLAND BREAKTHROUGH: A Global Call to Unlock the Power of Peatlands)
💚 Livestreaming für registrierte Teilnehmer der virtuellen COP30 verfügbar
Diese Veranstaltung wird gemeinsam von Wetlands International, der Michael Succow Stiftung, Partner im Greifswald Mire Centre, dem Global Environment Centre und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) in Zusammenarbeit mit anderen Partnern des Peatland Breakthrough organisiert, darunter die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (UNEP), die Global Peatlands Initiative, das Landscape Finance Lab, das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) und die Konvention über Feuchtgebiete (Ramsar Convention).
Zu unseren immer zahlreicher werdenden unterstützenden Partnern gehören: das Global Environment Centre, RE-PEAT und The Nature Conservancy.
Drei Förderaufrufe für Paludikultur-Projekte
Paludikultur in Umsetzung, junge Nachwuchswissenschaft, Wasser- und Nährstoffmanagement - dazu gibt es ab Oktober neue Förderaufrufe. Ideen entwickeln und bewerben geht bis Ende Januar 2026.
30/10/2025 Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat (BMLEH) möchte das Thema Klimaschutz durch Moorbodenschutz weiter vorantreiben und intensiviert die Forschungsförderung. Die drei im Oktober veröffentlichten Förderaufrufe adressieren zum einen die Bewirtschaftungstechnik für Paludikulturen , Wasser- und Nährstoffmanagement sowie den wissenschaftlichen Nachwuchs.
Durch die Förderung zu „Forschung zum Thema innovative Bewirtschaftungstechnik für den Anbau von Paludikultur“ soll insbesondere praxisnahe Forschung mit schnell verfügbarem Technologie- und Wissenstransfer im Bereich Landbewirtschaftung und Gewinnung von nachwachsenden Rohstoffen aus Paludikulturen unterstützt werden.
Jungforschenden stellt das Ministerium eine bis zu fünfjährige Förderung für die Erfassung und Modellierung von Daten auf wiedervernässten Moorstandorten in Aussicht. Die Förderung für „Wasser- und Nährstoffmanagement von Paludikulturen“ soll Wissen zu Hydrologie und Nährstoffversorgung von nassen Mooren und Paludikulturen auf Gebietsebene generieren.
Neue Moorbibliothek in Greifswald eröffnet

Wissensschatz und Begegnungsort für den Moorschutz
30/10/2025 Am 30. Oktober 2025 öffnete die Moorbibliothek im historischen Gebäude der „Alten Chemie“ in Greifswald ihre Türen.
Bei der feierlichen Eröffnung betonten prominente Gäste aus Wissenschaft, Politik und Zivilgesellschaft die Bedeutung des Ortes als Wissensspeicher und Plattform für den Austausch. Der Abend wurde musikalisch umrahmt von Zink und Geige und die Mitglieder des Stiftungskuratoriums nahmen die Besucher*innen mit auf eine Reise durch die Bücherlandschaft der Bibliothek – von historischen Werken, den wissenschaftlichen Klassikern bis zu Kinderbüchern.
Mehr unter: www.moorbibliothek.de
Kontakt: info@moorbibliothek.de
Neues Rechtsgutachten
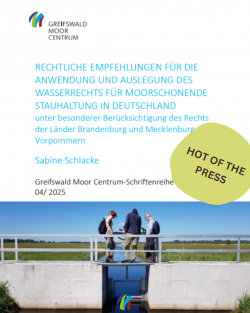
Für moorschonende Stauhaltung
27/10/2025 Moore sind zentrale Akteure im Klimaschutz, doch ihre Wiedervernässung scheitert oft an rechtlichen Hürden und gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ein neues Gutachten „Rechtliche Empfehlungen und Auslegung des Wasserrechts für moorschonende Stauhaltung in Deutschland“ erstellt von Prof. Dr. Sabine Schlacke, analysiert, wie das Wasserrecht in Deutschland besonders auch für nachhaltige Moornutzung angepasst werden muss. Die Kernaussage: Moorschonende Stauhaltung ist essentiell für den Erhalt von Mooren als CO₂-Speicher und für die Anpassung an den Klimawandel und muss daher gefördert werden - insbesondere in den Bundesländern Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Das Gutachten enthält Handlungsempfehlungen für Politik und Verwaltung, um Rechtssicherheit für Landnutzer:innen und Naturschutz zu schaffen.
Für Mecklenburg-Vorpommern sind die Empfehlungen des Gutachtens besonders relevant, da das LM MV einen Entwurf für die Novellierung des Landeswassergesetzes vorgelegt hat, über die aktuell die Ausschüsse des Landtags MV beraten. Hier bietet sich die Chance, Regelungen zur Erleichterung von Verfahren für Moorwiedervernässung einzufügen.
Das Gutachten richtet sich an Entscheidungsträger:innen in Politik, Verwaltung und Landwirtschaft und zeigt konkrete Wege auf, wie das Wasserrecht moorschonende Maßnahmen besser unterstützen kann. Es ist eine Publikation der GMC-Schriftenreihe, erarbeitet im MoKKA-Projekt Succow Stiftung.
Moor im Futurium
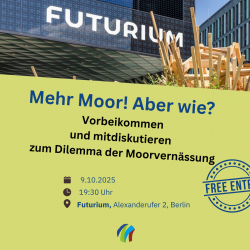
Mitduskutieren am 9.10.!
3/10/2025 „Mehr Moor! Aber wie?“ – unter dem Titel laden Futurium, die Joachim-Herz-Stiftung und das Greifswald Moor Centrum am 9. Oktober im Herzen Berlins. Moore sind zentrale CO₂-Speicher und gleichzeitig umstrittene Nutzflächen. Wie lassen sich Klimaschutz, Landwirtschaft und lokale Interessen vereinen? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Expertengesprächs mit Besucherbeteiligung ab 19:30 Uhr.
Moderatorin Katie Gallus spricht mit:
-
Lucas Gerrits, Co-Founder und Geschäftsführer Zukunft Moor GmbH
-
Juliane Petri, Landwirtin und landwirtschaftliche Beraterin aus dem Rhinluch/Kremmen
-
Dr. Franziska Tanneberger, Leiterin des Greifswald Moor Centrum
-
René Seltmann, Landwirtschaftliche Beratung Moorbodenschutz im Landesamt für Umwelt Brandenburg (LfU)
Die Veranstaltung im Futurium am Alexanderufer 2 in Berlin ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich.
Momentum für den Peatland Breakthrough

bei der New York Climate Week
24/09/2025 Der Peatland Breakthrough ist ein Aufruf zum Handeln, der darauf abzielt, systemische Veränderungen zum Schutz und zur Wiederherstellung von Mooren in großem Maßstab zu ermöglichen. Durch die Zusammenarbeit von Regierungen, Privatsektor, Förderorganisationen und der Zivilgesellschaft soll die Initiative dazu beitragen, den Erhalt, die Wiederherstellung sowie die nachhaltige und kluge Nutzung von Mooren weltweit zu beschleunigen – geleitet von soliden, wissenschaftlich fundierten Zielen und Prinzipien. Während der New York Climate Week 2025, am 25. September, kamen Regierungsvertreter*innen, Förderorganisationen, internationale Organisationen und Akteur*innen aus dem Privatsektor zu einem exklusiven hochrangigen Treffen zusammen, das von der Regierung von Peru und den Partnerorganisationen des Peatland Breakthrough ausgerichtet wurde. Das Treffen bot eine entscheidende Gelegenheit, breite Unterstützung zu mobilisieren und Partnerschaften zu stärken, um den Peatland Breakthrough voranzubringen – und sicherzustellen, dass Moore als zentrale naturbasierte Lösung für Fortschritte in der globalen Klimaagenda anerkannt werden.

Moore spielen eine herausragende Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels und der Erreichung der Ziele des Pariser Abkommens. Sie bedecken nur etwa 3 % der globalen Landfläche, speichern jedoch bis zu ein Drittel des gesamten Bodenkohlenstoffs – doppelt so viel wie die weltweite Waldbiomasse. Neben ihren Klimaschutzleistungen tragen Moore zur Resilienz von Gemeinschaften und Ökosystemen bei, indem sie Wasserflüsse regulieren, das Risiko von Überschwemmungen und Dürren verringern, Lebensräume für zahlreiche Arten bieten, Lebensgrundlagen sichern und die Wasserqualität verbessern. Der geschätzte globale Wert ihrer Ökosystemleistungen liegt bei etwa 2,3 Billionen US-Dollar.
Leider werden Moore weltweit degradiert – sie werden für Landwirtschaft und Forstwirtschaft entwässert, durch Überweidung geschädigt, für Brennstoffe und Gartenbau abgebaut und durch menschliche Aktivitäten verschmutzt. Infrastrukturprojekte beeinträchtigen ihre Hydrologie, viele werden absichtlich verbrannt. Wenn wir Moore als intakte Ökosysteme verlieren, verlieren wir nicht nur ihre Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern – sie setzen im Gegenteil große Mengen an Treibhausgasen frei. Degradierte Moore verursachen derzeit etwa 4 % der weltweiten menschengemachten Emissionen. Ihr Schutz, ihre nachhaltige Bewirtschaftung und die Wiederherstellung degradierter Flächen müssen daher Priorität haben, um Fortschritte im Klimaschutz zu beschleunigen.
Das Treffen brachte potenzielle Champion-Länder und strategische Partnerorganisationen zusammen, um mehr über den Peatland Breakthrough zu erfahren, mögliche Beiträge zu erkunden und die Vorteile einer Beteiligung sowohl vor der offiziellen Einführung als auch während der Umsetzung zu verstehen. Gastgeber war Juan Carlos Castro Vargas, Umweltminister von Peru, der die Rolle seines Landes als erstes Champion-Land des Peatland Breakthrough hervorhob.
Er betonte die Bedeutung gemeinsamen Handelns zwischen Staaten, Privatsektor und internationalen Partner*innen, um klare und messbare Ziele für den Schutz von Mooren und ambitionierte Klimaziele zu erreichen.
Im Anschluss an die Präsentationen der Initiative fanden Roundtable-Diskussionen mit hochrangigen Teilnehmenden aus der Republik Kongo, der Demokratischen Republik Kongo und Indonesien statt. Diese bekräftigten ihr Engagement für den Schutz ihrer Moore und betonten die Notwendigkeit ausreichender Finanzierung, um nationale Klimaziele zu erreichen.
Wetlands International, im Namen der Partnerorganisationen des Peatland Breakthrough, stellte die Entwürfe der globalen Zielsetzungen und Leitprinzipien vor, die kollektives Handeln und systemischen Wandel ermöglichen sollen. Die Organisation hob hervor, dass Investitionen in Moore zu den wirkungsvollsten Klimaschutzlösungen gehören – da sie Kohlenstoffspeicherung, ökologische Resilienz und wirtschaftliche Effizienz miteinander verbinden.
Potenzielle Förderinstitutionen und Partnerorganisationen, darunter The Nature Conservancy, Diageo, die Gordon and Betty Moore Foundation und die Margaret A. Cargill Philanthropies, bekundeten ihr Interesse, zum Fortschritt der Initiative beizutragen und ihre Aktivitäten sowie Investitionen mit den globalen Moor- und Klimaagenden in Einklang zu bringen.
Arlette Soudan-Nonault, Ministerin für Umwelt, nachhaltige Entwicklung und das Kongo-Becken sowie Exekutivsekretärin der Klimakommission des Kongo-Beckens, bekräftigte das Engagement der Republik Kongo für den Erhalt der intakten Moore des Kongo-Beckens. Sie betonte, dass Naturschutz ohne ausreichende Finanzierung für die Energiewende und die nationalen Klimabeiträge (NDCs) nicht möglich ist, da diese auf nationale Ressourcen und internationale Unterstützung angewiesen sind.
Zudem stellten Vertreter*innen des Umweltministeriums der Demokratischen Republik Kongo und des Forstministeriums Indonesiens ihre laufenden Moorschutzprogramme vor und betonten, dass der Peatland Breakthrough helfen kann, die nötigen Mittel zur Erreichung ihrer Klimaziele zu mobilisieren.
Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP) unterstrich die Bedeutung des Peatland Breakthroughs für die Erreichung der globalen Klimaziele und seine Relevanz für das Pariser Abkommen, insbesondere im Vorfeld der bevorstehenden Veranstaltungen bei der UNFCCC COP30. Die Zusammenarbeit und Führung durch Regierungen und Förderinstitutionen sei entscheidend, um das volle Potenzial der Moore zu entfalten. UNEP stellte den aktuellen Zustand der weltweiten Moore sowie Fortschritte durch gemeinsame Initiativen wie die Global Peatlands Initiative und deren Global Peatlands Assessment vor und betonte, dass Moore eine kosteneffiziente naturbasierte Lösung darstellen, die nicht übersehen werden darf.
Mara Angélica Murillo-Correa, Senior Programme Officer für zwischenstaatliche Angelegenheiten beim UNEP, fasste es zusammen: „Ohne Moore kein Paris.“ Der Schutz und die Wiederherstellung von Mooren seien entscheidend, um die Emissionslücke zu schließen und die biologische Vielfalt zu bewahren. Der Peatland Breakthrough biete die politische Dynamik und die finanzielle Ambition, um wissenschaftliche Erkenntnisse in transformative globale Maßnahmen umzusetzen.
Der Peatland Breakthrough ist ein gemeinsamer globaler Aufruf zum Handeln, geleitet von Wetlands International, dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen (UNEP), der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO), dem Greifswald Moor Centrum und dem Landscape Finance Lab, entwickelt in enger Abstimmung mit der Global Peatlands Initiative, den High-Level Climate Champions und der Ramsar-Konvention.
Zu den wachsenden unterstützenden Partnerorganisationen zählen das Global Environment Centre, RE-PEAT und The Nature Conservancy.
Image 1: Environmental ministers and leaders from NGOs and the private sector at the Permanent Mission of Peru to the UN, New York (Credit: GPI)
Image 2: Roundtable discussions ensued following exciting presentations on the Peatland Breakthrough (Credit: GPI)
Druckfrisch
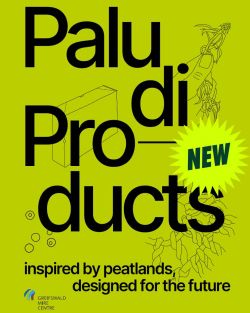
Der erste Paludi-Produktkatalog
24/09/2025 Frisch vorgestellt auf der RRR2025-Konferenz: Der erste Paludi-Produktkatalog überhaupt! Mit so vielen Pilotprodukten, Prototypen und Dienstleistungen rund um die Paludikultur, wie wir zusammenstellen konnten. Ziel ist es, einen umfassenden Überblick zu geben und zu zeigen, wie vielfältig, innovativ und marktfähig diese neue Form der Landnutzung bereits heute ist.
Um das Innovationspotenzial dieses Bereichs aufzuzeigen und die Vielfalt der bestehenden Produkte hervorzuheben, richtet sich der Katalog an:
• Landwirte – um die bestehende Nachfrage nach Biomasse aus Paludikultur für eine breite Palette von Produkten aufzuzeigen.
• Unternehmen – die bereits Biomasse aus Paludikultur verarbeiten oder dies planen, um Inspiration und Möglichkeiten zur Vernetzung zu bieten.
• Forschung, Politik und Gesellschaft
Das Besondere daran: Der Katalog ist offen für weitere Beiträge und wird in Zukunft regelmäßig aktualisiert und erweitert. Alle neuen und bestehenden Paludi-Produkte können aufgenommen werden.
Der Katalog wird auf der „Renewable Resources from Wet and Rewetted Peatlands – 4th International Conference on the Utilisation of Wetland Plants” vorgestellt, die Teil des Projekts PaludiZentrale ist. Wenn Sie ein Produkt im Katalog platzieren möchten, können Sie das Katalogteam per E-Mail unter produktkatalog@greifswaldmoor.de kontaktieren.
Neue europäische Moorkarte

jetzt online verfügbar
23/09/2025 Die Europäische Moorkarte (EPM2025) steht nun auf unserer Website zum kostenfreien Download, inklusive der Geodaten bereit. Sie ist ein Produkt der Global Peatland Database (GPD), die vom Greifswald Moor Centrum (GMC) betrieben wird, und trägt zu einer einheitlichen und regelmäßig aktualisierten Wissensbasis über Moore weltweit bei.
Der Datensatz bietet den aktuellsten Überblick über europäische Moorgebiete. Die EPM2025 integriert aktuelle nationale, regionale und lokale Datensätze zu Mooren und organischen Böden einschließlich degradierter und entwässerter Moore, d. h. solcher, die für die Landwirtschaft genutzt werden. Durch das Bereitstellen der Daten im Vektorformat bietet die Karte eine hohe räumliche Auflösung und damit eine unverzichtbare Ressource für Forschung, Politik und Naturschutz.
Die EPM2025 basiert auf dem Moor-Layer der Europäischen Feuchtgebietskarte (2024), ist jedoch direkt zugänglich, ohne dass eine Extraktion aus der umfassenderen Feuchtgebietsebene erforderlich ist. Sie aktualisiert die „Peatland Map of Europe“ (Tanneberger et al. 2017), wobei alle nationalen Datensätze überprüft und durch umfassendere oder qualitativ bessere GIS-Daten ersetzt wurden. Den Geodaten zufolge beträgt die Gesamtfläche der Moorgebiete in den erfassten Ländern 38,4 Millionen Hektar (384.220 km²).
Die EPM2025 wurde im Rahmen von zwei EU-finanzierten Horizon-Projekten (ALFAwetlands und WET HORIZONS) und der Europäischen Klimaschutzinitiative (EUKI) des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) erstellt und repräsentiert den besten verfügbaren Wissensstand auf europäischer Ebene. Noch wichtiger ist, dass sie als gemeinsame und sich weiterentwickelnde Wissensbasis konzipiert ist und die Wissenschafts- und Naturschutzgemeinschaft einlädt, Daten auf nationaler und regionaler Ebene in ganz Europa weiter zu überprüfen, zu verfeinern und kontinuierlich zu verbessern.
Book of Abstract fertig

Voller Überblick zur RRR2025
20/09/2025 Fertig zum Durchblättern: unser Book of Abstract zur 4. internationalen Konferenz „Renewable Resources from Wet and Rewetted Peatland – RRR2025”. Neben einem Überblick über das Programm und praktischen Informationen gibt es die ausführlichen Beschreibungen aller Keynotes, Exkursionen, Sitzungen und Workshops.









